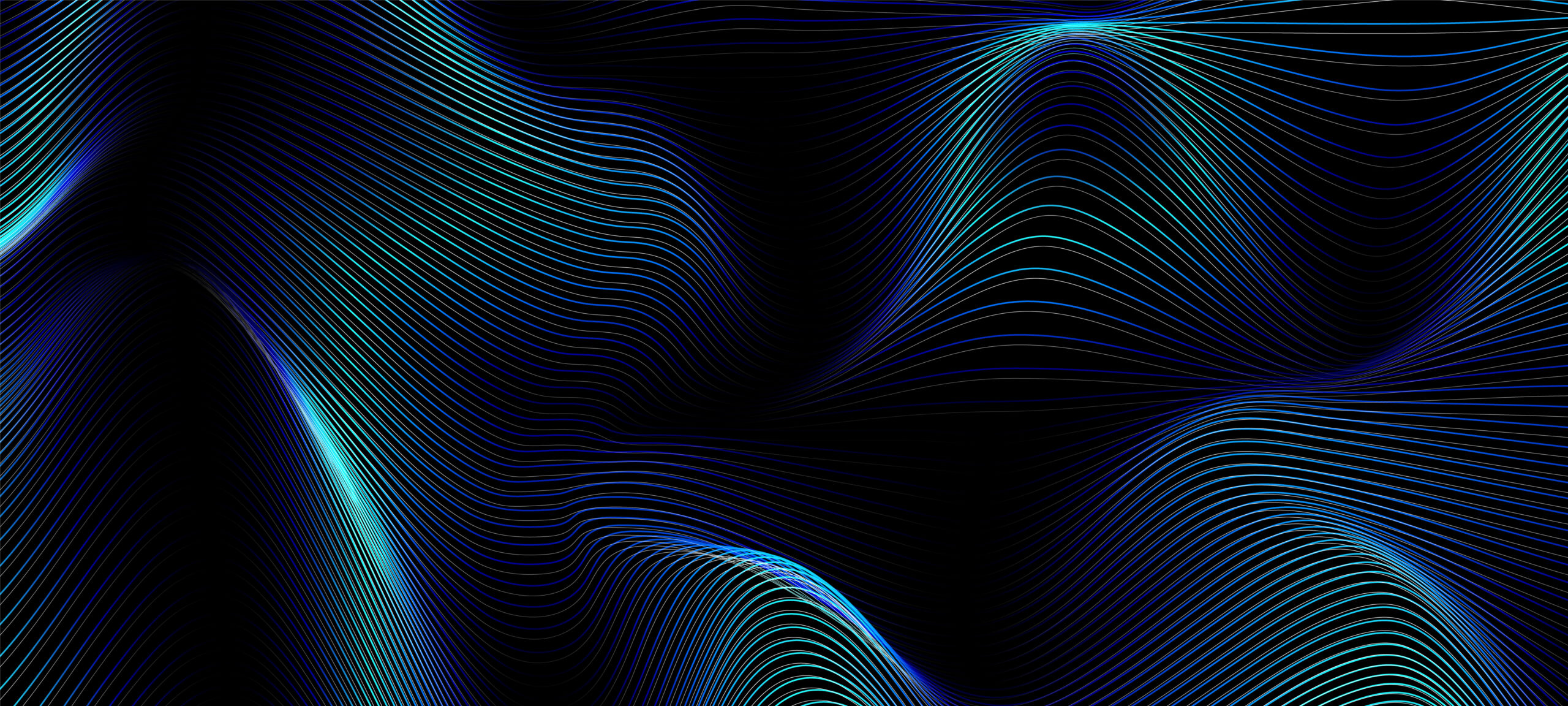Man kann sich nicht daran gewöhnen, selbst wenn der Hormonspiegel die ganze Zeit hoch ist?
Das Problem ist, dass er die ganze Zeit hoch bleibt, weil man sich eben nicht daran gewöhnt hat. Normalerweise gibt es tatsächlich eine psychologische Gewöhnung. Wenn man zum Beispiel nicht so gerne öffentlich vorträgt, dann macht man das ein, zwei, drei Mal – und ist sehr gestresst. Aber beim vierten Mal ist es nicht mehr so schlimm, beim fünften Mal noch weniger. Man hat sich daran gewöhnt. Es hängt auch davon ab, ob man einen positive Grundeinstellung hat oder nicht. Es gibt dazu eine schöne Untersuchung aus den USA. Dort wurden 30.000 Personen befragt, wie ihr Stresslevel in den letzten Jahren war. Hatten sie gar keinen Stress, hatten sie mittel viel Stress oder hatten sie richtig viel Stress? Nach acht Jahren wurden die Studienteilnehmer noch einmal analysiert.
Dabei zeigte sich, dass jene, die keinen Stress gehabt hatten, keine erhöhte Mortalität aufwiesen, also keine erhöhte Sterblichkeitsrate. Die mit viel Stress hatten eine. Allerdings zeigte sich in dieser Gruppe auch: Nur diejenigen, die überzeugt waren, der Stress schade ihrer Gesundheit, wiesen eine erhöhte Mortalität auf. Die Studienteilnehmer, die zwar viel Stress hatten, aber nicht glaubten, dass der Stress ihnen gesundheitlich schade, hatten keine erhöhte Mortalität. Es kommt also auch stark auf die eigene Einstellung zum Stress an.
Kann man denn auch süchtig nach Stress werden?
Ja, das gibt es. Zum Beispiel im Sport. Wenn man ans Limit geht, sorgt das für eine Dopaminausschüttung, also für positive Gefühlserlebnisse, nach denen man süchtig werden kann.
Auch mit Entzugserscheinungen?
Da muss man differenzieren. Was war das, was mir diese Freude oder diese Glücksgefühle bereitet hat? Was vermisse ich jetzt? Ist es der Stress an sich, oder war das eine Sache, die zwar stressvoll war, aber die Freude gemacht hat, weil die Arbeit so interessant und spannend war, ich vielleicht große Bewunderung durch andere Leuten erfahren habe. Das war dann zwar stressig, aber es war positiv konnotiert. Und das möchte ich wieder fühlen.
„Es hängt auch davon ab, ob man einen positive Grundeinstellung hat“
Also ist es nicht die beunruhigende Ruhe an sich, wenn der Körper in den normalen Modus zurückkehrt, die dieses Suchtgefühl hervorruft?
Wenn die Dopaminrezeptoren die ganze Zeit feuern und das plötzlich fehlt, dann fehlt es auch dem Körper. So als würden Sie plötzlich aufhören zu rauchen oder Alkohol zu trinken.
Gibt es denn einen Unterschied bei den Geschlechtern? Sind Frauen anfälliger für Stress oder Männer?
Tatsächlich reagieren Männer und Frauen unterschiedlich bei Stress, auch hormonell, aber das ist so differenziert, dass man keine pauschale Aussage treffen kann. Grundsätzlich ist Stress eine universelle Reaktion, bei Tieren genauso wie bei Menschen. Wenn ich ein Tier ärgere, reagiert es mit der gleichen Stress-Hormonantwort wie der Mensch. Das kann ich messen. Wenn das System die ganze Zeit auf Hochtouren läuft, hat es irgendwann einen schädlichen Einfluss auf den Körper. Diese Schwelle ist aber unterschiedlich. Denn jeder von uns hat eine unterschiedliche Vulnerabilität, also Verwundbarkeit, oder auch Resilienz. Aber egal wie hoch diese Schwelle ist, sie kann natürlich geknackt werden. Und dann entwickeln wir eine stressassoziierte Erkrankung, zum Beispiel auf der Ebene der Psyche klassischerweise eine Depression, Angststörung oder auch Suchterkrankung.
Jemand, der etwa die ganze Zeit im Beruf entweder qualitativ toxischen Stress hat, weil er oder sie gemobbt wird, angefeindet von Kollegen oder wirklich quantitativ einfach zu viel arbeitet, mit 12-Stunden-Schichten die ganze Zeit. Und wenn er dann nach Hause kommt, ist er so angespannt unruhig, dass er erstmal drei Feierabendbiere braucht.