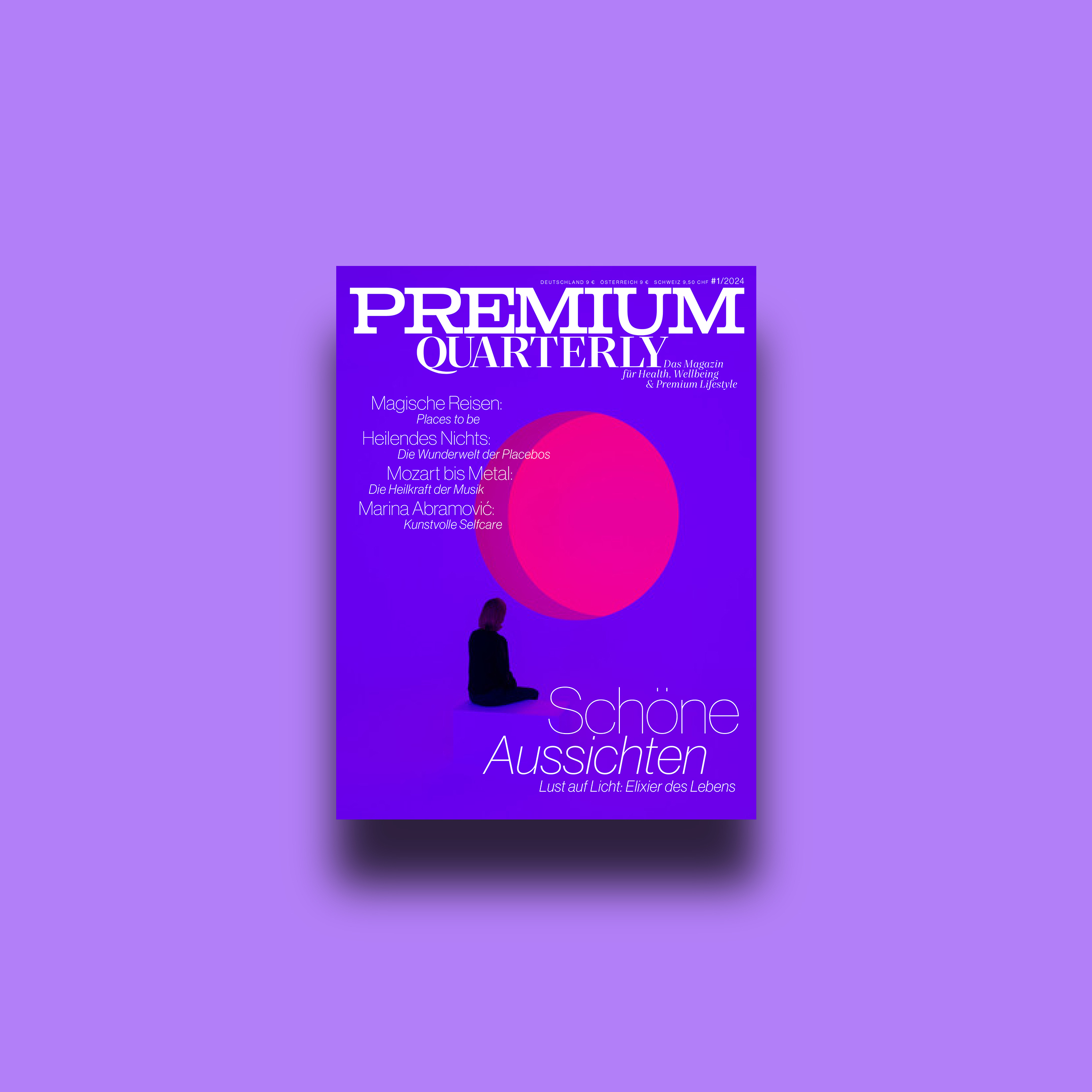Was hat das für Ursachen?
Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus meiner Praxis. Vor Kurzem hatte ich eine Patientin, Mitte 50. Vor einem Jahr habe sie einen Herzinfarkt gehabt, erzählte sie, und jetzt wolle sie noch mal nachsehen lassen. Sie sagte, es gehe ihr ganz gut, aber hin und wieder habe sie so ein komisches Gefühl. Manchmal spüre sie auch ein bisschen Druck, aber das gehe dann wieder weg. Sicher sei das psychologisch, sagte sie.
Im Gespräch stellte sich heraus, dass sie vor zwei Jahren ihren Ehemann verloren hatte und sich seitdem in Dauerstress befand. Sie wirkte niedergeschlagen und überfordert. Ich machte einen Ultraschall, ein EKG und sah mir die Halsschlagader an. So weit war nichts auffällig.
Zur Sicherheit nahm ich noch Blut ab. Als die Blutwerte kamen, wiesen sie erhöhte Entzündungswerte auf. Schließlich stellte sich heraus, dass sie einen Herzinfarkt hatte, wenn auch keinen lebensbedrohlichen. Ein paar Stunden später war sie im Krankenhaus und ich setzte ihr einen Herzkatheter und drei Stents.
Warum ich das erzähle? Weil sie komplett durch das Raster hätte fallen können. Eine Bitte um Kontrolle, keine Auffälligkeiten bei den Tests, keine typischen Beschwerden, nichts weiter als ein komisches Gefühl. Deshalb ist es so wichtig, Patienten und Patientinnen zuzuhören und aufmerksam zu sein.
Gendermedizin wird gelegentlich mit Frauenmedizin gleichgesetzt. Aber auch Männer werden bei einigen Volkskrankheiten falsch behandelt. Etwa bei Osteoporose. Wie kommt es dazu?
Der Algorithmus im Kopf sagt: Frau, Wechseljahre, Östrogenmangel, Osteoporose. Das liest man auch immer wieder. Aber ab 65, 70 ist die Häufigkeit von Osteoporose bei Frauen und Männern etwa gleich groß.
Eigentlich logisch, denn der Abbau der Knochen beginnt ab 40, das gilt natürlich auch für Männer. Bricht sich ein älterer Mann bei der Gartenarbeit den Unterschenkel, geht er in die Notaufnahme, bekommt einen Gips und geht nach Hause.
Aber allzu häufig fragt niemand: Warum ist das eigentlich so? Das ist schade, denn Osteoporose lässt sich zumindest reduzieren, mit Physiotherapie und Muskelaufbau kompensieren und mit entsprechenden Medikamenten auch der Abbau der Knochen verhindern.
Auch bei der Diagnose und Behandlung von Depressionen sind Männer im Nachteil. Anzeichen für eine depressive Erkrankung werden häufig nicht erkannt. Woran liegt das?
Männer haben bei Depressionen oft andere Symptome, etwa in Form von Sucht- und erhöhtem Aggressionsverhalten. Der klassische Fragebogen, mit dem Depressionen diagnostiziert werden, fragt das aber nicht ab. Er orientiert sich an Frauen. Deshalb werden Depressionen bei Män-nern nicht so häufig erkannt.
Frauen leiden in Europa doppelt so häufig an Depressionen als Männer. Aber die Suizidrate liegt bei Männern dreimal höher als bei Frauen. Belegt das die These?
Auf jeden Fall. Und Männer schotten sich bei Depressionen eher ab und tun sich deutlich schwerer damit, den ersten Schritt zu machen, als Frauen. Häufig fürchten sie, als psychpathisch zu gelten, Schwierigkeiten im Job zu bekommen, nicht mehr der starke Mann oder angreifbar zu sein. Und flüchten sich in Süchte.
Deshalb ist es so wichtig für Familie, Freunde und Bekannten, denjenigen darauf anzusprechen. Und am besten dort hinzubringen, wo ihm geholfen werden kann, sei es beim Psychologen, beim Psychiater, bei Psychotherapeuten oder Neurologen.
Wie zuversichtlich sind Sie, dass der Ansatz der Gendermedizin sich in den nächsten Jahren durchsetzt?
Die Pharmafirmen werden ihre Studien umstellen müssen. Dadurch wird es entsprechende Daten geben, der Gender Data Gap wird kleiner. Das wird dazu führen, dass Beipackzettel unterschiedliche Dosierungen für Frauen und Männer beinhalten. Auch in der Wissenschaft wird das Thema Zukunft haben.
Gendermedizin unterscheidet das Geschlecht. Aber es gibt weitere Kriterien, die auf Krankheiten Einfluss haben.
Ziel der Gendermedizin ist auch nicht, bei der Unterscheidung von Mann/Frau/Divers stehen zu bleiben. Sondern ein Portfolio an Parametern zu berücksichtigen, zu dem Faktoren wie Genetik, Umwelteinflüsse, Größe, Körper-masse, Muskel- und Fettanteil zählen.
Mehr Informationen zu diesem Thema: Prof. Dr. med. Burkhard Sievers betreibt auf YouTube den Channel „Sievers Sprechrunde„.