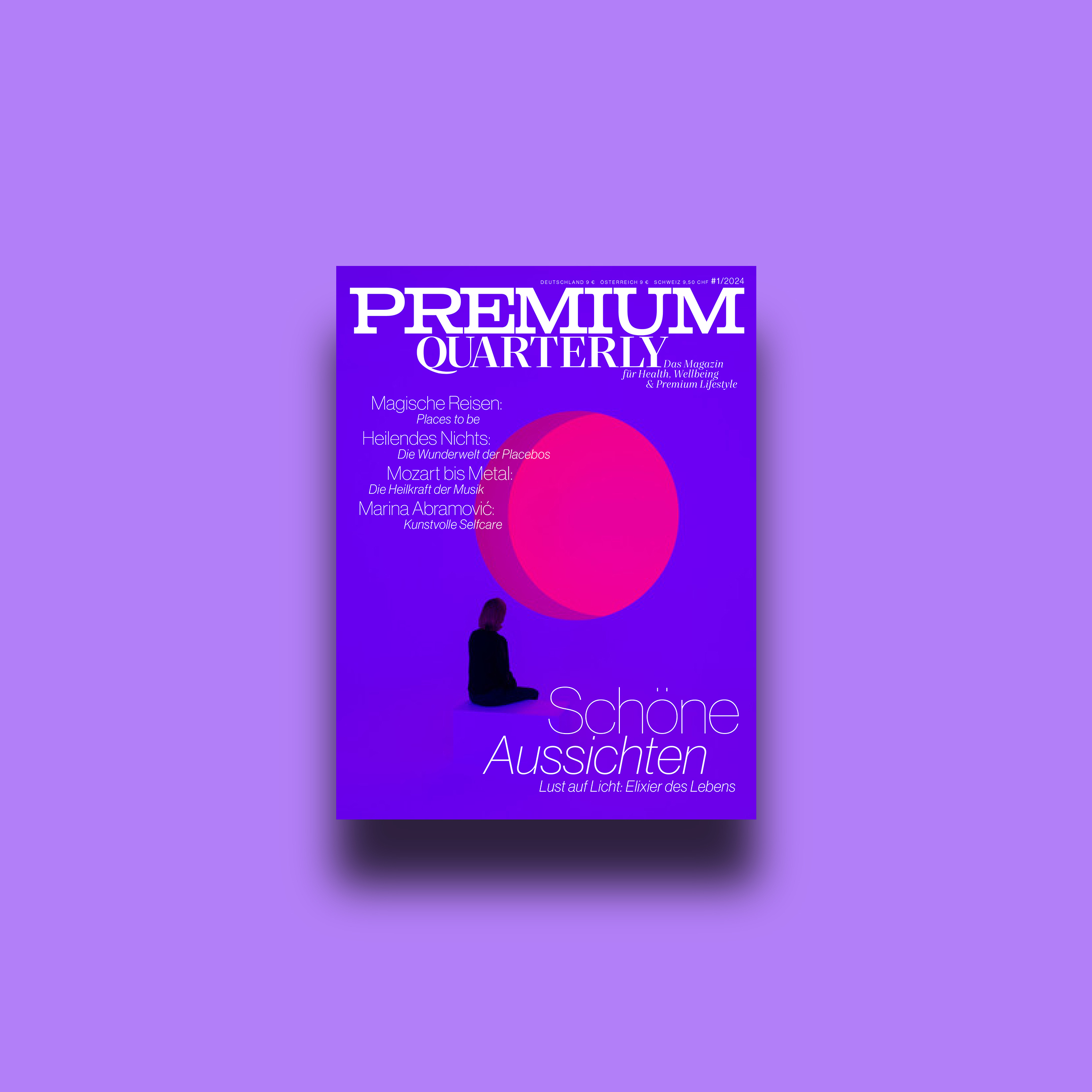Was sind Psychedelika?
Psychedelika, das klingt erst mal schwer nach Sixties. Nach Love, Peace und Happy Hippies. Als das Who‘s who der Popkultur, von Musik bis Malerei, Kreativität und mystische Erfahrung in veränderten Bewusstseinszuständen durch LSD oder Magic Mushrooms suchte. Nach heutigem Wissen war dies, zumindest was die Kreativitätssteigerung betrifft, eher überbewertet. Wer nicht kreativ ist, wird es auch nicht durch psychoaktive Substanzen. Interessant sind sie jedoch aus medizinischer Sicht. Studien dazu gab es schon in den 1950er-Jahren, nachdem der Schweizer Chemiker und LSD-Entdecker Albert Hofmann Ende der 1930er-Jahre aus den magischen Pilzen das Psilocybin isolieren konnte. Die Studien waren jedoch methodisch nicht ausreichend und schwierig zu interpretieren. Dann kam die Forschung zum Erliegen, denn in der Ära Nixon wurden Psychedelika zuerst in den USA, dann auch in Europa als Drogen verboten.
Das Comeback der Psychedelika
Doch nun bahnt sich eine Art Comeback an. Neue Sinn- und Kreativitätsuchende, nunmehr aus dem Silicon Valley, und aktuelle Netflix-Dokumentationen wie Verändere dein Bewusstsein, Magic Medicine oder Goop Lab brachten Psychedelika in den vergangenen Jahren wieder ins öffentliche Bewusstsein. Prof. Dr. Andreas Menke, ärztlicher Direktor und Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie im Medical Park Chiemseeblick, sieht aber auch einen medizinisch relevanten Grund für das Revival: „Wir haben bei der Depression mit Antidepressiva seit den 1950er-Jahren gute Behandlungsmöglichkeiten. Weiterentwickelt hat sich die Verträglichkeit, nicht maßgeblich jedoch Wirkung und Wirkmechanismen.“ Klassische Medikamente wirken zwar, jedoch erst nach vier bis sechs Wochen und immerhin bei einem Drittel aller Patienten gar nicht. Diese Lücke könnten Psychedelika ganz gut ausfüllen, so Menke.
Psilocybin für die Behandlung von Depressionen
Aktuell werden dazu auch in Deutschland klinische Studien über Psilocybin durchgeführt, etwa an der Berliner Charité und am Mannheimer Zentralinstitut für Seelische Gesundheit. Ziel der Forschung: eine legale und sichere medizinische Anwendung zur Therapie behandlungsresistenter Depression zu ermöglichen. Die ersten Ergebnisse stimmen zuversichtlich, dass die Behandlung in den nächsten Jahren von der FDA und der EMA zugelassen wird.
Was macht Psilocybin so interessant? Es aktiviert Serotonin-Rezeptoren, die Dopamin- und Glutamat-Ausschüttung, sorgt also für Glücksgefühle und Harmonie, stimuliert die Neuroplastizität und damit die Weiterentwicklung der Nervenzellen, darüber hinaus hat es antientzündliche Effekte. Auch scheint es das sogenannte Default Mode Network, einen neurologischen Mechanismus, der die Alltagswelt im Gehirn stabilisiert, vorübergehend außer Kraft zu setzen. Und damit die rigide Art über sich zu denken, wie dies bei manchen Depressionsarten der Fall ist. Man sorgt also bewusst für Unordnung und ermöglicht so eine Neuordnung.
Die an den Studien teilnehmenden Patienten erhalten eine Standarddosis Psilocybin in einem vorbereiteten ruhigen Umfeld in der Klinik. Im Beisein von Therapeuten erleben sie dann einen tagtraumähnlichen Zustand, der vier bis sechs Stunden anhält – ein Vorteil gegenüber LSD, das deutlich länger wirkt. Anschließend erfolgt eine sogenannte Integration, eine Nachbereitung mit Psychotherapie. Wie lange die Effekte halten und wie häufig die Gabe erfolgen kann, ist noch Gegenstand der Studien. Vertragen wird Psilocybin in der Regel gut. Auch besteht nach heutigem Wissen keine Suchtgefahr, allenfalls eine Verhaltensfixierung.