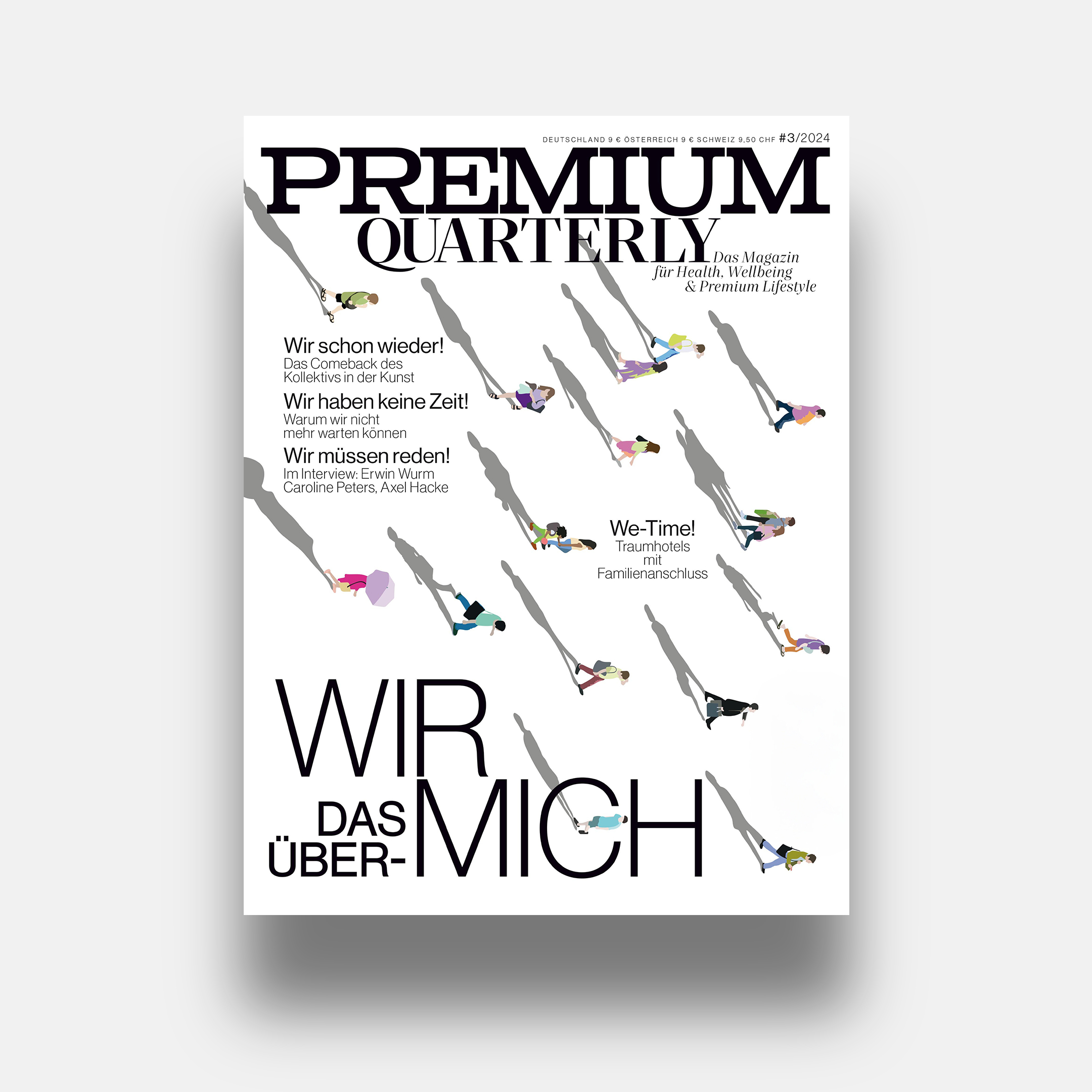Trotz Deiner langjährigen Erfahrung bei der DKMS – gab es Aspekte der Krebsbehandlung, die Dich als Patientin überrascht haben?
Also ich bin überrascht, wie viel man dann doch durchlaufen muss. Das ist etwas, was ich in der Theorie natürlich durch meinen Job weiß. In dem Moment, wo aber eine Person vor einem steht und einem einen Laufzettel mitgibt und sagt, dass wir jetzt sehr, sehr schnell handeln müssen, weil der Tumor sehr groß ist, wird einem der Umfang nochmal anders bewusst.
Innerhalb von fünf Tagen hatte ich jeden Tag mehrere Termine. Termine, die man eben wahrnehmen muss. Und am Ende der fünf Tage stand dann ganz klar fest: Es handelt sich um Brustkrebs. Es war besonders diese Fülle an Dingen, die man machen muss.
Von außen betrachtet wirkt das oft sehr oberflächlich, und das ist auch völlig in Ordnung. Niemand sollte sich zu detailliert mit dem Ablauf einer Krebstherapie auseinandersetzen müssen, bevor es wirklich nötig ist. Es reicht, sich damit zu beschäftigen, wenn die Diagnose tatsächlich gestellt wird.
Trotzdem ist mir aufgefallen, dass selbst ich – obwohl ich schon lange mit Patient:innen arbeite und sie oft über Monate hinweg begleite – letztlich nur einen oberflächlichen Eindruck davon hatte, was das wirklich bedeutet.
Es gibt keinen festen Plan, dem man einfach folgen kann, und oft bleibt man mit Unsicherheiten allein
Plötzlich wird einem klar: Krank zu sein ist ein Vollzeitjob. Tägliche Kontrolluntersuchungen, zahllose Termine, unzählige Formulare, die man ausfüllen muss, und ständig Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Es gibt keinen festen Plan, dem man einfach folgen kann, und oft bleibt man mit Unsicherheiten allein. Diese ständige Unsicherheit hatte ich so nicht erwartet.
Ich habe immer wieder diese Momente gehabt, wo ich nicht wusste, was ich jetzt tun muss. An wen ich mich wenden muss. Wo ich hin muss. Und wie oft ich Freunde angerufen habe und gesagt habe – wir müssen das jetzt durchdiskutieren, helft mir, Entscheidungen zu treffen.
Das hat mich tatsächlich überrascht. Ich habe gedacht, dass man anders vorbereitet wird. Das wird man am Ende dann doch nicht.
Verglichen mit anderen Betroffenen war ich wahrscheinlich trotzdem besser vorbereitet, aber nicht so sehr, wie ich es mir in meiner Naivität vorgestellt hatte.
Wie sah Dein Behandlungsplan aus und wie hast Du die ersten Schritte auf diesem Weg erlebt?
Wir mussten direkt starten mit dem vollen Programm. Mir wurde gesagt, dass es ein sehr schnell wachsender und bösartiger Tumor ist. Das bedeutete, dass ich Chemotherapie, Operation und Bestrahlung durchlaufen musste.
Interessant ist, dass man in dem Moment nur funktioniert. Man kriegt einen Plan und man arbeitet den Plan ab und man funktioniert.
Das ist eigentlich das Einzige, was man so vor sich hat und davon ist man schon total erschöpft. Ich mache das jetzt Schritt für Schritt. So war mein Gefühl.
Jeder reagiert anders auf die Chemotherapie, und ich glaube, man kann sich gut vorstellen, dass diese Erfahrung sehr belastend sein kann
Zwischen finaler Diagnose und Chemo lagen bei mir zwei Wochen. Das ist ein relativ kurzer Zeitraum. Da wird man reingeschleudert. Ich habe im April 2023 meine Chemo gestartet. Insgesamt 16 Einheiten. Man kann kaum beschreiben, wie das ist. Jeder reagiert anders auf die Chemotherapie, und ich glaube, man kann sich gut vorstellen, dass diese Erfahrung sehr belastend sein kann. Trotzdem hatte ich, im Vergleich zu vielen Geschichten, die ich aus meinem beruflichen Umfeld kenne, Glück. Meine Erfahrungen waren weniger schlimm, als ich ursprünglich befürchtet hatte.
Welche Strategien hast Du entwickelt, um mit dieser Situation umzugehen? Was hat Dir besonders geholfen, Kraft zu schöpfen?
Viele Dinge passieren, ohne dass man sie sich vorher als Strategie zurechtlegt. Ich habe im Laufe der Zeit gemerkt, dass das anscheinend etwas ist, was ich für mich manifestiert habe und was mir dann irgendwie ein gutes Gefühl gegeben hat.
Als man mir gesagt hat, dass ich Brustkrebs habe, gab es keinen Moment, an dem ich geweint habe, bis heute nicht. Es gibt mal Momente, die einen berühren und man Tränen in den Augen hat, weil man die nächste Hürde geschafft hat, zum Beispiel. Aber meine erste Reaktion auf die Diagnose war überraschend rational.
Ich sagte zur Ärztin: ‚Ich habe gerade gelesen, dass eine von acht Frauen im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs erkrankt.‘ Sie schaute mich nur an und fragte: ‚Haben Sie verstanden, was ich Ihnen gerade gesagt habe?‘ Ich antwortete: ‚Ja, ich bin eine dieser Frauen.‘
Vielleicht liegt es daran, dass ich seit 17 Jahren beruflich mit dem Thema Krebs zu tun habe. Das hat diesem Wort ‘Krebs’ etwas von seinem Tabu und Schrecken genommen. Damit will ich die Krankheit keineswegs verharmlosen – überhaupt nicht. Aber ich habe sofort realistisch gedacht: ‚Okay, andere haben es auch geschafft, dann schaffe ich das auch.‘
Ein wichtiger Punkt für mich ist auch, dass ich entschieden habe, mit der Erkrankung wahnsinnig offen umzugehen. Das prägt auch einen Satz, den ein Freund am ersten Kontrolltag zu mir gesagt hat:
“Ab jetzt zählt, dass du überlegen musst, was du brauchst. Du sagst uns, was du brauchst.”
Ganz am Anfang entschied ich für mich: Bewegung wird ein Keyfaktor für mein Wohlbefinden sein
Der Satz hat mich die ganze Zeit begleitet, weil ich das selber nicht kenne, dass ich denke – was brauche ich denn jetzt eigentlich? Was das ja impliziert, ist, sich selber an erste Stelle zu setzen oder vielleicht auch zu merken – das wird mir zu viel, was brauche ich jetzt, um mich besser zu fühlen?
Ganz am Anfang entschied ich für mich: Bewegung wird ein Keyfaktor für mein Wohlbefinden sein. Solange es mir möglich ist, werde ich mich jeden Tag bewegen. Und tatsächlich habe ich während der gesamten Chemotherapie nur an einem Tag darauf verzichten müssen, weil es einfach nicht ging. Ansonsten war ich jeden Tag draußen, immer mit jemandem an meiner Seite – und das hat mich durch die ganze Zeit getragen: mein Umfeld.
Ich habe meinem Umfeld ‚Google-Aufträge‘ gegeben, wie zum Beispiel: ‚Welche Ernährung unterstützt die Chemotherapie?
Ich habe außerdem entschieden — und das ist widersprüchlich zum Journalismus, wir tendieren ja eigentlich dazu, dass wir alles genau wissen wollen — dass ich nichts googeln werde. Ich wollte nicht mal meinen Tumor oder die Therapie googeln. Stattdessen habe ich meinem Umfeld ‚Google-Aufträge‘ gegeben, wie zum Beispiel: ‚Welche Ernährung unterstützt die Chemotherapie?‘ Sie haben mir dann kleine PDF-Zusammenfassungen geschickt, was mir geholfen hat.
Am Ende war es das Loslassen, das für mich eine der größten Herausforderungen darstellte. Ich bin ein Planungsmensch, aber in dieser Situation fremdbestimmt zu sein und nicht genau zu wissen, wie es weitergeht, war eine echte Challenge. Zu lernen, Schrittchen für Schrittchen Dinge anzugehen, hat mir wahnsinnig geholfen. Konzentrieren, das Abarbeiten und flexibel zu bleiben.
Wie hast Du Dein Umfeld einbezogen und welche Erfahrungen hast Du dabei gemacht?
Das Einzige, was mir anfangs wirklich Sorgen bereitet hat, war der Gedanke, dass ich alleine sein würde und diesen Weg alleine gehen müsste. Doch schon am ersten Tag, an dem ich meine Diagnose öffentlich gemacht habe, hat sich eine Gruppe von Freunden zusammengetan, die seitdem aktiv an meiner Seite ist.
Es gab keinen Arzttermin, zu dem ich alleine gehen musste, es sei denn, ich wollte es. Sie haben mich zu jedem Termin begleitet, mich unterstützt und aufgefangen. Nach jeder Chemositzung war immer jemand da, der mich nach Hause gebracht hat. Es gab keinen Moment, in dem ich mich einsam gefühlt habe – und ich glaube, das war ein ganz entscheidender Faktor.
In dem Moment, wo man sich einsam und alleine fühlt, glaube ich, dass es einen mental massiv runterziehen kann und das wirkt sich natürlich auch auf das komplette Körpergefühl und die Heilung aus.
Da habe ich großes Glück, dass meine Freund:innen und Kolleg:innen mich von Anfang an aufgefangen haben.
Dadurch war es auch immer ein sehr offenes Thema im beruflichen Kontext, also ich habe von Anfang an gesagt – Okay, ich möchte, dass wir darüber reden, ich kommuniziere das offen und ich kommuniziere das zu jedem, egal ob es mein Vorgesetzter ist, ein: Werkstudent:in oder auch die Personalabteilung, weil ich finde, wenn wir in einer Krebsorganisation nicht über das Thema Krebs sprechen können, dann sind wir falsch und auch das ist ein Punkt, der mir geholfen hat.
Kein Mensch weiß, wie es einem geht, wenn man seine Haare verliert, das wusste ich auch nicht
Ich habe zweieinhalb Wochen nach der ersten Chemotherapie die Haare verloren. Als ich es bemerkte, bin ich zunächst zum Friseur gegangen und habe sie kürzer schneiden lassen. Ich habe dann meinen Freund:innen gesagt, okay, können wir uns in dieser Woche treffen und die Haare ganz abrasieren?
Für einen Mittwoch habe ich mich dann mit zwei Freundinnen verabredet. Am Donnerstag darauf war die zweite Chemo angesetzt. Am Mittwochmorgen bin ich aufgestanden und – darüber war ich auch überrascht – es lagen wirklich dicke Haarbüschel auf dem Kissen.
Dieses Gefühl abends, als die Mädels kamen und wir alles runtergeschnitten und dann runterrasiert haben, das war eine Erleichterung.
Ich habe in den Spiegel geguckt und ich fühlte mich so befreit von diesem komischen Rest, den ich auf dem Kopf hatte. Während meine Freundinnen weinten, habe ich gelacht und immer wieder gesagt: ‚Es ist okay, wirklich, es ist okay.‘ Ich hatte mich im Vorfeld mit Perücken und Tüchern vorbereitet, aber letztlich habe ich nichts davon getragen.
Ich habe beschlossen, dass ich mich am wohlsten fühle, wenn ich die Situation so annehme, wie sie ist. Wer damit nicht klarkam, sollte eben wegschauen – aber für mich war es viel einfacher, offen damit umzugehen. Der Verlust der Haare bringt eine besondere Sichtbarkeit mit sich. Vorher oder auch jetzt, wo die Haare nachwachsen, ist das nicht so ein Thema, das ist vergessen. Wenn jemand nicht krank aussieht, ist er nicht krank.
Aber die Haare – das macht die Krankheit für andere so offensichtlich. Diese Sichtbarkeit kann bei anderen eine gewisse Befremdlichkeit auslösen, und das habe ich selbst bei Freund:innen und Kolleg:innen gespürt. Durch meine offene Kommunikation habe ich diese Barriere schnell abgebaut.
Auch zu meiner Familie habe ich von Tag eins gesagt, dass wir das nicht wegschweigen können. Ich habe meiner Schwester von Anfang an gesagt: ‚Es ist wichtig, dass ihr mich fragt, wie es mir geht, oder wie mein Tag war. Ich kann nicht immer von mir aus alles erzählen, also müsst ihr mir helfen.‘
Und das haben sie bis heute durchgezogen. Es war sehr wichtig für mich, dass man nicht am Tisch sitzt und da ist dieser Elefant im Porzellanladen. Es hat mich selbst überrascht, wie klar ich plötzlich Dinge formulieren konnte, ohne darüber nachzudenken. Als meine Schwester bei unserem ersten Gespräch fragte, was sie tun kann, obwohl sie so weit weg ist, habe ich spontan geantwortet: ‚Melde dich regelmäßig und frag nach.
Ich kann nicht immer die Energie aufbringen, selbst zum Telefon zu greifen.‘ Ich war erstaunt, wie einfach es mir fiel, klare Bedürfnisse zu formulieren und einzufordern, was mir sonst immer sehr schwer fiel. Aber es hat uns allen geholfen. Ganz viele Leute, Freunde und Familie, haben immer gesagt, dass man so hilflos und machtlos ist, weil sie alle nichts tun können, außer mir das Gefühl zu geben, wir sind an deiner Seite.
In dem Moment, wo sie sich selbst eine Aufgabe geben konnten, ging es jedem besser. Es ist interessant, wie wir Menschen in Krisensituationen oft das Bedürfnis haben, aktiv zu werden. Selbst kleine Aufgaben können uns das Gefühl geben, dass wir die Situation besser bewältigen können und im Griff haben.