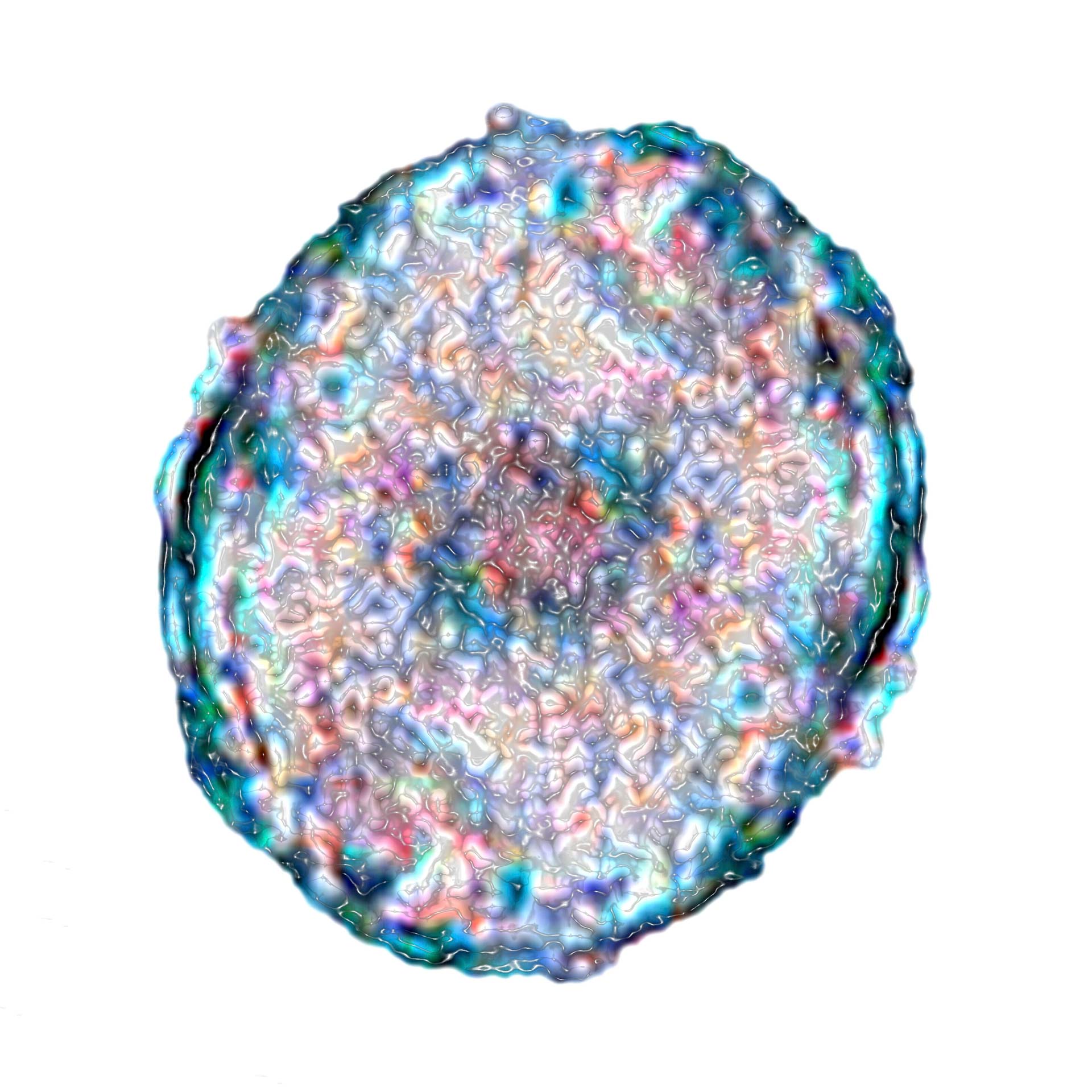Die Neurologin Professor Ulrike Bingel leitet seit 2020 an der Universität Essen das Forschungsprojekt „Treatment Expectation“, einen Verbund von 19 Teams aus Neurologen, Psychologen, Psychiatern, Physikern und Biologen.
Frau Professor Bingel, der zentrale Begriff der Placeboforschung lautet „positive Erwartung“. Was genau ist damit gemeint – das Naturell eines Menschen oder die Erwartung
in einer bestimmten Situation?
Es geht um die Erwartung, die auf eine Therapie, einen körperlichen oder seelischen Zustand gerichtet ist. Wenn ich etwa ein bestimmtes Medikament einnehme, wird das bestimmte Folgen haben. Erwartung ist keine Charaktereigenschaft, sondern ein dynamisches Konstrukt. Sie kann sich im Laufe des Lebens verändern, je nachdem, welche Erfahrungen man macht und welche Informationen man erhält – und wie man diese dann für sich bewertet.
Wie positiv muss die Erwartung sein, damit der Körper Prozesse auslöst, die zur Heilung beitragen?
Wie viel Erwartung richtig ist, ist sehr unterschiedlich und lässt sich nicht pauschal beantworten. Positiv ausgerichtete Erwartung ist besser als keine Erwartung zu haben. Und viel besser als negative Erwartung. Die Erwartung darf aber auch nicht übersteigert sein. Wenn sie so hoch ist, dass der Körper sie nicht erfüllen kann, bricht die Erwartung und das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient nimmt Schaden.
Wenn ich Kollegen berate, wie sie am besten mit Patienten kommunizieren, rate ich dazu, immer realistische Ziele zu setzen. Oft lässt sich eine Behandlung schon verbessern, indem man Patienten mit negativen Erfahrungen wieder zu einer offenen Erwartung verhilft und sie von Befürchtungen befreit.
Welche Faktoren haben Einfluss auf die Erwartungshaltung?
Für manche Patienten ist es hilfreich, die Wirkweise von Medikamenten zu verstehen. Für einige auch, den Erfolg einer Therapie bei anderen Menschen beobachtet zu haben. Wieder andere stimmt es positiv, einen informativen Artikel zu lesen. Und bei manchem löst der Satz „Wenn Sie meine Mutter wären, würde ich es genauso machen“ eine positive Erwartung aus. Es gibt unterschiedliche Wege, die Erwartung in die richtige Richtung zu lenken.
Wie ist es zu erklären, dass der Placebo-Effekt auch dann eintreten kann, wenn der Patient weiß, dass er ein Placebo, also ein Medikament ohne Wirkstoff erhält?
Das ist ein spannendes Phänomen. Wir wissen nur, dass es funktioniert. Aber nicht genau, warum, für wen und wie lange diese Effekte halten. Ich habe darauf keine Antwort, denn mit Erwartung hat das ja erst mal nichts zu tun.
Ich vermute, dass mir ein Open-Label-Placebo – ein Medikament, von dem der Patient weiß, dass es keinen Wirkstoff enthält – insbesondere dann helfen kann, wenn ich offen für die Idee bin, dass es mir helfen kann.
Geht es mir dann eines Morgens besser, was ja auch im natürlichen Verlauf von Erkrankungen mal passiert, schlage ich diese Verbesserung dem Open-Label-Placebo zu. So baut sich mit der Zeit durch Erfahrungen, die ich möglicher weise ohnehin gemacht hätte, eine Erwartung auf. Ich kann das nicht belegen, aber Studien unterstützen diese Vorstellung, da sich diese Effekte meistens erst nach sieben bis zehn Tagen einstellen.
Das bedeutet, dass ein Open-Label-Placebo nicht wie ein Lichtschalter funktioniert, den man einschaltet, son-dern das Placebo gleicht eher einem trojanischen Pferd, das einen öffnet für diesen Prozess und Selbstheilungs-kräfte selbstwirksam nutzbar macht. Die Zeit und zukünftige Forschung wird zeigen, welchen Stellenwert die OLPs im klinischen Alltag bekommen. Vielleicht werden sie mal ein Mosaikstein in unserem therapeutischen Armamentarium.
Der Königsweg besteht für mich aber darin, nicht unbedingt die Placebos, sondern die Erwartung zu nutzen, um bestehende und zu entwickelnde Therapien wirksamer und verträglicher zu machen.
Ein Ziel ihres Forschungsprojekts ist es, den Effekt positiver Erwartungen verstärkt in Therapien einzusetzen. Bei welchen Krankheitsbildern ist das möglich bzw. sinnvoll?
In unserem Forschungsprojekt untersuchen wir den Effekt von Erwartungen auf chronische Schmerzen und Depressionen. Es gibt unzählige Studien, in denen neue Medikamente gegen Placebos getestet werden.
Und daraus wissen wir, dass bis zu zwei Drittel des gesamten Behandlungserfolgs bei Schmerz und Depression auf Placeboeffekte zurückzuführen sind. Deshalb sind das dankbare Forschungsfelder. Und sie sind extrem relevant, denn Depression und Schmerzen liegen in den Rankings der häufigsten Erkrankungen ja immer ganz vorne.
Das heißt, es gibt einen großen Bedarf, bestehende Therapien zu optimieren. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht auch bei anderen Erkrankungen sinnvoll ist, diese Effekte zu nutzen.
Wie lassen sich die Effekte positiver Erwartung dafür nutzen?
Ziel unserer Forschung ist es, bestehende Medikamente verträglicher zu machen, ihre Wirksamkeit zu steigern und ihre Nebenwirkungen zu verringern, indem man die Effekte positiver Erwartung nutzt. Die neuen Antikörpertherapien, etwa gegen Migräne, sind ein Segen, sehr wirksam, aber auch sehr teuer.
Benötigt man weniger Wirkstoff, erhöht sich die Wirksamkeit, und man könnte die Medikamente auch mehr Menschen anbieten. Auch Verträglichkeit ist ein großer Punkt. Jedes Jahr landen Tausende von Tonnen Medikamente im Müll, weil Menschen Angst vor der Therapie haben, schlechte Erfahrungen gemacht haben oder sich um Verträglichkeit sorgen. In der klinischen Realität dominieren also leider die Noceboeffekte.
Also die Umkehrung des Placeboeffekts, wenn negative Erwartungen die Wirksamkeit eines Medikaments oder einer Therapie bremsen. Es war zu lesen, dass Soziale Medien Noceboeffekte verstärken können.
Wir wissen, dass Medien, nicht nur Soziale Medien, großen Einfluss haben auf die Erwartungen von Patienten. Es gibt dazu tatsächlich Studien, etwa zu den Nebenwirkungen von Coronaimpfungen. Das Ergebnis: Je häufiger jemand Posts und Medienberichte gelesen hat über unerwünschte Nebenwirkungen, desto häufiger traten Nebenwirkungen wie Armschmerzen, Fieber oder Schüttelfrost auch auf. Das ist ein Problem, das uns noch lange beschäftigen wird.
Wie lassen sich Noceboeffekte vermeiden?
Das Beste, was man unternehmen kann, um den Noceboeffekt so klein wie möglich zu halten, sind Kommunikation und gute Aufklärung. Die meisten Patienten bekommen ein Rezept in die Hand gedrückt mit dem Satz: bitte zweimal täglich! Aber worin der individuelle Nutzen der Behandlung liegt, wie ein Medikament im Körper wirkt, wird häufig gar nicht kommuniziert.
Oder denken Sie an Beipackzettel, das sind Nocebotreiber par excellence! Dort ist auf drei Seiten ja nur von Tod und Verderben die Rede, aber weniger, wofür das Medikament gut ist. Das kommt aus dieser alten Denke, ein Medikament dockt an einen Rezeptor an, und dann gibt es eine Reaktion. Das stimmt zwar, aber eben nur zum Teil. Denn zusätzlich zu dieser spezifischen Wirkung auf Moleküle und Rezeptoren spielen Erwartungseffekte mit hinein und beeinflussen, ob sich etwas besser oder schlechter entwickelt.
Für ausführliche Gespräche ist im Praxisalltag wenig Zeit.
Das ist ein Riesenproblem. Dass Kommunikation ein essenzieller Bestandteil von Behandlung ist, der dazu führt, dass Medikamente besser wirken oder überhaupt eingenommen werden, diese Erkenntnis ist in der Begeisterung für das biomedizinische Verständnis, das sich vor rund 150 Jahren entwickelt hat, verloren gegangen.
Heißt das, dass die Erforschung von Placeboeffekten auch als Wiederbelebung alten medizinischen Wissens zu verstehen ist?
Ich sehe darin eine Renaissance von Heilkunst, die inzwischen empirisch begründet ist. Phänomenologisch ha-ben die großen Denker der Antike das alles schon beschrieben. Unser Ziel ist es, das wissenschaftliche fundierte Wissen, dass Kontext und Kommuni-kation eine wichtige Rolle spielen, in die Schulmedizin zu integrieren.
Heißt das auch, dass die der Homöopathie zugesprochenen Wir-kung in erster Linie auf dem Effekt positiver Erwartung beruht?
Genau. Was bei homöopathischen Behandlungen wirkt, wissen wir: Kommunikation, personalisierte Strategien, Vertrauen, Rituale – all das ist empirisch belegt. Das heißt, was bei der Homöopathie wirkt, sind nicht die Globuli, sondern das Vertrauen, dass ich in die Methode und die ärztliche Erstanamnese setze.
Alles andere entbehrt jeder Logik und jeder wissenschaftlichen Erkenntnis. Die Homöopathie vereint eine Reihe von Dingen, von denen wir wissen, dass sie positive Erwartungen und Placebo-Effekte maximieren. Nur die Globuline braucht es nicht.