
Dr. Siegfried Marquardt – Leiter der Praxis Zahngesundheit am Tegernsee
21. März 2023
Christine Bürg und Robert Emich
Digital Health ist – nicht nur bei Zahnärzt:innen – in aller Munde. Mit welchen Herausforderungen sehen sich Mediziner:innen konfrontiert, wenn es darum geht, mit den neuesten Technologien zu arbeiten? Drei Expert:innen berichten aus ihrem ärztlichen Alltag
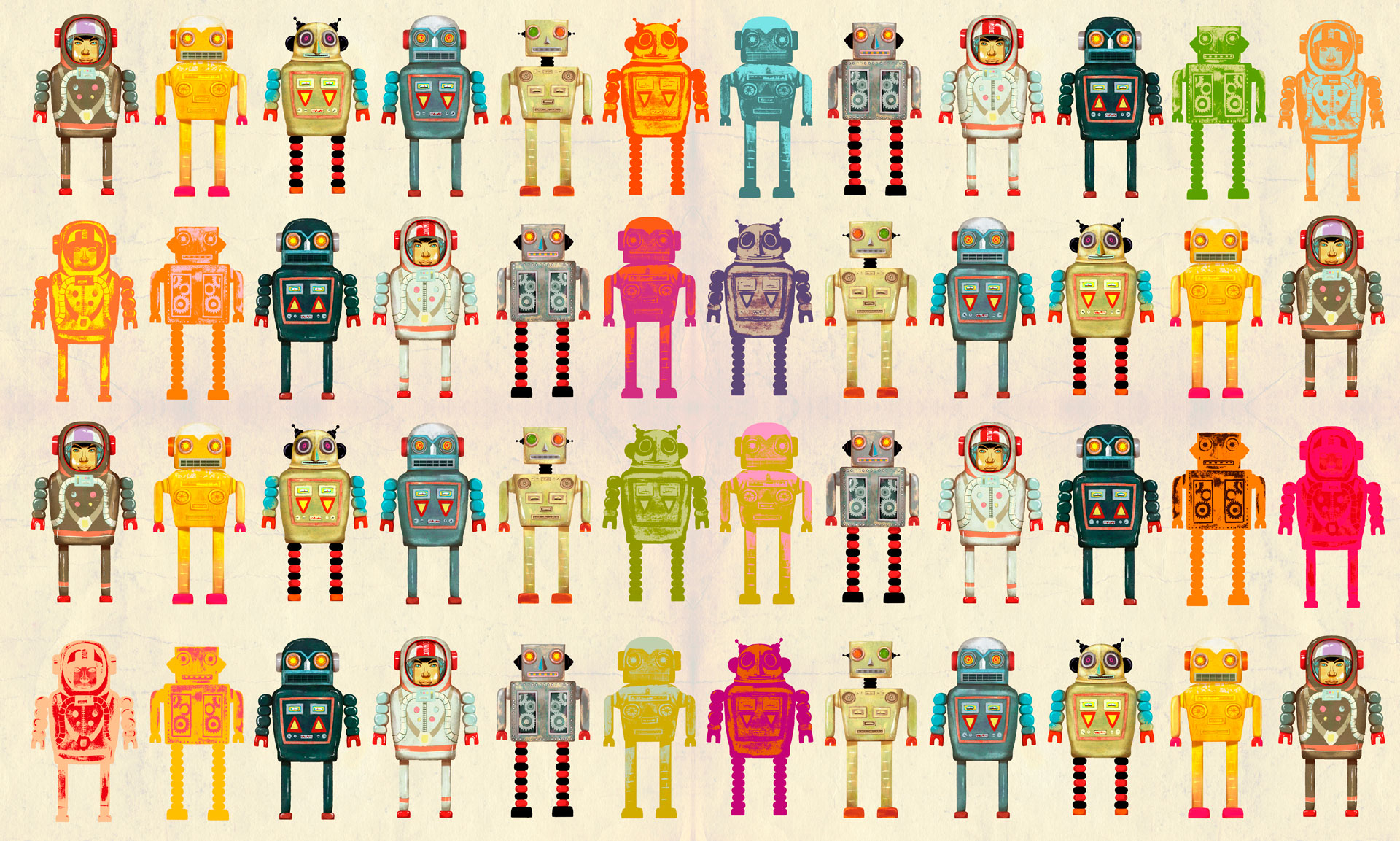
© Illustration: Andy Ward/Ikon Images

Dr. Siegfried Marquardt – Leiter der Praxis Zahngesundheit am Tegernsee
Die Patienten haben heute eine hohe Erwartungshaltung, was den Einsatz von digitaler Technik betrifft. Man muss jedoch genau differenzieren, wann die digitale Revolution ein Segen ist und wo sie an ihre Grenzen stößt. Im Moment gibt es viele tolle Einzelaspekte. Beispielsweise in der Implantologie. Man kann wunderbar ein Implantat setzen, sofort danach seine Position einscannen, diese Daten innerhalb von Minuten dem Techniker schicken und nach drei, vier Stunden die fertige Krone auf das Implantat schrauben. Das ist tatsächlich revolutionär, die Genauigkeit inzwischen perfekt und alltagstauglich. Sobald wir aber drei, vier, fünf Implantate haben, wird es kritisch. Dann schleichen sich schon Ungenauigkeiten ein, und man braucht mehr analoge Krücken, um der Digitalisierung auf die Sprünge zu helfen.
Oder: wenn mir ein Patient sein Lächeln schenkt, das nicht passt, weil es irgendwie „schief“ ist aufgrund von Zahnfehlstellungen, lässt sich mit dem Facescanner der gesamte Kopf inklusive seiner Bewegungen komplett digitalisieren und ein Avatar schaffen. Wir können dann morphen und mit dem Patienten diskutieren, was wir alles verändern würden für eine perfekte Restauration. Schaue ich dann aber in den Mund, stelle ich fest: schwierig. Weil die Stellung einzelner Zähne so ungünstig ist, dass man der Natur kein Schnippchen schlagen kann. Das heißt, die Idealvorstellung eines digitalen Morphings in die Realität umzusetzen, funktioniert am Ende nicht immer.
„Digitalisierung ersetzt nicht den guten Mediziner“
Wir arbeiten auch sehr viel mit der modernen Invisalign- und Align- Technologie, den Teslas in der Zahnmedizin. Der Marktführer Invisalign hat weltweit die meisten Daten, weil es mehr als 14 Millionen Fälle gibt. Und die Datenmenge ist für die KI entscheidend. Kieferorthopädische Behandlungen, Kieferumstellungen und Zahnbegradigungen auf Grundlage der KI funktionieren perfekt in der Planung und auch in der Ausführung. Auch was Funktionsprobleme im Kiefergelenk betreffen, können wir digital unglaubliche Dinge feststellen, was wir früher eigentlich nur manuell ertasten konnten. Selbst wenn ich heute einen Abdruck mache, also analog arbeite, steckt der Techniker das Modell in seinen Scanner und digitalisiert es.
Für die Planung – gerade bei komplexen Fällen – ist die Digitalisierung eine große Hilfe, weil ich gewisse Dinge voraussehen kann, die ich in einer analogen Welt nicht gesehen habe. Doch die Digitalisierung braucht eine Lernkurve von einem halben Jahr bis Jahr, damit ich weiß, wo die Macken eines Gerätes sind, wo ich mich wie verhalten muss, warum diese Fehlermeldung auftritt und so weiter. Es gibt computer-affine Leute, die einen Zugang dazu haben, und dann gibt es andere, vor allem ältere Kollegen, die sagen: „Das fasse ich nicht mehr an.“ Die Jungen wiederum, die aus der Uni kommen, möchten alles nur digital machen. Und stellen dann fest: „Hoppla, das geht ja gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe!“
Was auch richtig gut funktioniert, ist der Intraoralscan. Patienten mit Würgereiz bei einem klassischen Zahnabdruck strömen in unsere Praxen, weil ihr alter Zahnarzt diesen Scanner nicht hat. Aber wenn ein guter Zahnarzt sein Handwerk in der analogen Form beherrscht, würde ich mich als Digitalexperte nicht trauen zu sagen meine Arbeit ist besser. So weit sind wir noch nicht. Die Digitalisierung ersetzt also nicht den guten Mediziner. Noch wichtiger ist das übrigens in der Zahntechnik. Das könnte in Zukunft ein Problem werden, weil die jungen Zahntechniker fast nur noch am Computer sitzen und nicht wissen, wie ein Kauorgan funktioniert und wie man einen Zahn so formt, dass alles zusammenpasst. Dass etwa die Kauflächen nicht zu hoch sind. Deshalb rate ich jedem Zahntechniker: „Bitte geh erstmal durch die Lehre und mache noch die alte Schule. Dann kannst Du die Funktion in einer digitalen Welt viel, viel besser nachvollziehen und besser umsetzen.“
Was die Robotik in der Zahnheilkunde betrifft: Um einen Roboter einzusetzen, muss vorher alles digitalisiert werden. Dann kommt die Schablone rein und man merkt, dass der Patient in Achse vier und fünf eine andere Zahnfleischdicke hat, die das Gerät nicht genau kalibrieren konnte. Und dann hat der Roboter noch eine Genauigkeit von vielleicht 98 Prozent. 2 Prozent Fehlerquote bei einem Nerv-Verlauf bedeutet ungefähr 0,5-1 Millimeter. Wenn ich diesen einen Millimeter Fehlplanung hab, dann bin ich im Nerv drin, und es besteht die Gefahr einer Lähmung. Da macht also keinen Sinn. Wenn ich als erfahrener Arzt ein Implantat setze, brauche ich dafür ungefähr 20 Minuten, muss kurz vorbereiten, den Patienten aufklären, eine 3D-Aufnahme anfertigen, damit ich weiß, wo der Nerv liegt. Und das war‘s. Der Roboter braucht schätzungsweise einen Tag Vorbereitung, danach muss er programmiert und von jemandem navigiert werden, der mit dem Joystick umgehen kann. Das ist gar nicht finanzierbar. Deswegen macht Robotik, wenn es darum geht, einen Zahn zu präparieren oder ein Implantat zu setzen, momentan keinen Sinn.
„Ein Facelift durch einen Roboter wird es noch lange nicht geben“
Die Digitalisierung in der plastischen, ästhetischen und rekonstruktiven Chirurgie hilft uns sowohl bei der OP-Planung als auch im Operationssaal selbst. Durch Apps und Kamerasysteme können wir heute bereits im Vorfeld simulieren, welchen Effekt zum Beispiel eine Brustkorrektur hätte. Im OP selbst arbeiten wir nach wie vor mit Röntgenbildern und MRTs. Hier wäre es hilfreich, wenn wir nach einem Unfall beispielsweise eine Fraktur mit Hilfe einer Brille direkt auf das OP-Feld übertragen könnten.
In der plastischen Chirurgie sind KI und Big Data ein Thema, wie es sie in der Brustdiagnostik für Mammakarzinome schon gibt. Es geht darum, dass wir mit Hilfe von Geräten, die durch Erfahrung lernen, bestimmte Befunde erkennen könnten – vielleicht sogar schneller und effizienter als ein Radiologe. In der Radiologie funktioniert die KI momentan nur unterstützend, aber es ist nur eine Frage der Zeit, wann die Maschinen das selbstständig übernehmen können und wir dann die Entscheidung der KI freigeben. Entwicklungen wie Chat GPT werden uns einen Teil der Bürokratie abnehmen können, zB bei Arztbriefen und Anträgen für Versicherungen.
Für eine Einzelpraxis, wo nicht Millionen an Forschungsgelder zur Verfügung stehen wie an einer Uni-Klinik, sind es andere Facetten der Digitalisierung und Modernisierung, die wir nutzen können, bei uns muss alles gleich umsetzbar sein und einen unmittelbaren Patientenvorteil mit sich bringen, denn wir können ja nicht experimentieren. Selbstverständlich sehe ich mir an, was international passiert – vor allem in Asien und den USA – und entscheide dann, ob ich einen Weg mitgehe oder nicht. Schließlich möchte ich mich immer weiterentwickeln – zum Wohle der Patienten. Man sollte immer offen sein für Entwicklungen, up to date bleiben und im Austausch mit Kollegen. Ich finde es gefährlich, wenn Leute sagen: „Das habe ich schon immer so gemacht“. Überheblichkeit ist prinzipiell verwerflich. Man sollte immer mit einer gewissen Demut schauen, was man verbessern kann. Die Patienten sind heute auch wesentlich besser informiert.
Für mich persönlich ist die Arbeit im Laufe der Karriere leichter geworden ist. Zum einen, weil ich viel Erfahrung habe und Situationen und Patienten besser einschätzen kann. Zum anderen aufgrund der erwähnten digitalen Möglichkeiten, aber auch Entwicklungen in nicht-digitalen Bereichen der Medizin. Es gibt viele Verbesserungen an Geräten, in der Narkose, bei Medikamenten. Wenn wir die Entwicklung vergleichen mit dem, was vor 20 Jahren war, dann hat sich doch sehr viel getan. Auch wenn wir bei Digital Health noch ein bisschen Geduld haben müssen, bis sie in der Therapie angekommen ist, bin ich überzeugt, dass sich die Robotik im OP in vielen Bereichen durchsetzen wird. Kleine Bewegungen, die man als Chirurg macht, kann ein Roboter in noch viel kleinere, präzise Bewegungen umsetzen. Im Bereich der Mikrochirurgie wird das auf jeden Fall eine Hilfe sein. Ein Facelift durch einen Roboter wird es noch längere Zeit nicht geben, aber irgendwann vielleicht dann doch auch. Ich denke, dass zuerst die Visualisierung kommen wird, bevor im großen Stil mit Robotik operiert wird. Eine 3D-Brille ist schließlich um eines günstiger als ein Roboter. Ich glaube, dass wir den Fortschritt täglich erleben, manchmal nur nicht so bewusst. Vor 100 Jahren sind Kinder noch an Diabetes gestorben, dann kam das Insulin, und jetzt ist es selbstverständlich, dass sie über ihr Handy den Blutzucker messen. Ein anderes Beispiel ist die Tranexamsäure, mit der wir Blutungen stillen können. Es ist heute völlig normal, dass ich zur Visite komme und die Patienten nach einem Facelift oder einer Lidstraffung fast keine Hämatome mehr haben.
Ein großes Thema ist auch die Stammzellentherapie – sei es im ästhetischen oder im regenerativen Bereich. Wir versuchen schon seit Jahren, Organe zu rekonstruieren. Hier werden Stammzellen eine große Rolle spielen. Auch ich arbeite im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben fast an jedem OP-Tag mit Stammzellen, denn im Eigenfett haben wir extrem viele davon. Dieses Potential nutze ich bei Narben, für Rekonstruktionen, für Brustvergrößerungen und für Hautbehandlungen.
Ein weiteres großes Zukunftsthema ist Longevity. Die Patienten werden immer älter bei immer höherer Lebensqualität. Ich habe viele Patienten über 80, die noch aktiv und fit sind und sich das erhalten möchten. Das sind auch diejenigen, die Zeit haben und eine gewisse Kaufkraft. Eine Altersdiskriminierung darf hier nicht stattfinden. Vor allem kleinere OPs sind selbst bei 80-Jährigen nachgefragt – Lidstraffungen zum Beispiel und Faltenunterspritzungen, aber schon auch mal ein Facelift.

Dr. Caroline Kim – Plastisch-Ästhetische Chirurgin mit eigener Praxis in München

Augenarzt Raphael Neuhann, Klinischer Leiter des Ophtalmologikums sowie des Keratokonus & Hornhaut Transplantationszentrums München
Wenn wir von Digital Health sprechen, müssen wir unterscheiden zwischen dem medizinischen Part und der Kommunikation mit Patienten. In der Augenheilkunde wird bereits seit vielen Jahren digital gearbeitet, Stichwort Lasertechnologie und Linsenersatz. Wir haben aber immer noch Probleme damit, die gewonnene Datenmenge vernünftig zu nutzen. Die Diagnose muss meist erst mal ausgedruckt und aufs Fax gelegt werden. Beispiel Makuladegeneration, die viele ältere Patienten betrifft: diese brauchen rund ein Jahr lang jeden Monat eine Spritze. Das Spritzen selbst dauert vielleicht fünf Minuten. Aber die Terminvereinbarung für die Erstdiagnose, für die Kontrolltermine danach, die nicht alle von Anfang an koordiniert werden können – hier würde stärkere Digitalisierung helfen.
Was die Hornhautlaserchirurgie angeht, also das klassische Brille weglasern bei jüngeren Patienten, kann man getrost behaupten, dass dies heute zu den sichersten digital unterstützen Behandlungen am Menschen zählt und die häufigsten. Aber selbst die modernsten Lasersysteme werden teilweise noch mit einem Drucker geliefert, um das Behandlungsprotokoll auf Papier auszudrucken. Das Praxissystem mit dem Lasersystem direkt zu verbinden, ist zwar möglich, ist aber häufig nicht so trivial, wie man meinen möchte. Und möchte dann der Arzt, der den Patienten überwiesen hat, die Behandlungsdaten haben, müssen diese trotzdem wieder ausgedruckt und händisch verschickt oder gefaxt werden, damit dieser Arzt sie scannen und in sein System übertragen kann. Das heißt, die Kommunikation zwischen den Ärzten ist schlecht, weil es keine standardisierten Patientenakten gibt, obwohl das technisch möglich wäre.
„Der Kostenfaktor ist zwar immens, doch wenn man mit der Zeit gehen will, muss man in neue Technologien investieren“
Ähnlich ist es auf der Lieferantenseite. Wir haben eine hervorragende Technologie für die OP-Durchführung, aber beim Vernetzen aller Informationen und darin, den Workflow effizient zu gestalten, hapert es noch. Wir haben heute hochindividualisierte Linsen. An einem OP-Tag werden schon mal 20 unterschiedliche Linsen implantiert. Es ist also wichtig, dass die Implantate den einzelnen Patienten richtig zugeordnet werden können. Jede Linse hat einen Barcode, der eingescannt wird, es braucht aber immer noch analoge Checks, um sicher zu gehen, dass der Patient die richtige Linse in das richtige Auge eingesetzt bekommt. Und es gibt viele Hürden dazwischen, weil die Software der Geräte verschiedener Hersteller nicht kompatibel sind.
Es ist es aber schon so, dass die Technik enorm hilfreich ist. Dass Blinde durch einen Netzhautchip wieder sehen können, ist momentan zwar noch Zukunftsmusik aber es wird intensiv daran geforscht. Es gibt zum Beispiel heute schon einen Chip, der es Menschen, die ihre Sehleistung verloren haben, wieder ermöglicht, Strukturen in einem Raum zu erkennen und sich besser zu orientieren.
Stichwort Makuladegeneration: Hier glaube ich an die Entwicklungen in der Präventionsmedizin. Dass man analysieren und durch Algorithmen vorhersagen wird können, wie sich das Risiko für eine Makuladegeneration reduzieren lässt. Wenn jemand die genetische Veranlagung dafür hat, kann man die Erkrankung durch aktive Prävention zwar nicht verhindern, das Fortschreiten jedoch verlangsamen und die Makulaerkrankung soweit kontrollieren, dass es zu keinen erheblichen Einschränkungen kommt. Stand Februar 2023 wurde nun auch das erste Medikament zur Behandlung der trockenen Makuladegeneration (geographische Atrophie) zugelassen..
Die meisten Augenärzte sind sehr technikaffin. Der Kostenfaktor ist zwar immens, doch wenn man mit der Zeit gehen will, muss man in neue Technologien investieren. Man könnte wahrscheinlich alle fünf bis acht Jahre einen neuen wesentlich verbesserten Hornhautlaser kaufen, andere Geräte jedoch aber noch verwenden, auch wenn sie vielleicht noch von 1980 sind. Manchmal rechtfertigt die Verbesserung eines Geräts nicht den finanziellen Aufwand und den Nutzen für die Patienten.
In der Diagnostik tut sich viel mehr, da könnte man jedes Jahr neue Geräte kaufen.Es gibt ständig neue Funktionen und Technologien. Die Biometrie des vorderen Augenabschnitts beispielsweise war immer kamerabasiert. Seit einiger Zeit gibt es nun einen Laser mit hochauflösenden Scans. Das ist sensationell, weil wir Dinge sehen können, die wir noch nie gesehen haben.
Neu ist also häufig besser, schneller, weniger belastend für den Patienten. Aber man hat immer die Übergangsphase von etablierter zu neuer Technologie. Auch wenn einige meinen, es braucht den Arzt für manche Diagnosen oder Behandlungen gar nicht nicht mehr, ist er für die Patienten umso wichtiger – um Ängste zu nehmen, um zu erklären. Aber auch, um zuzuhören und von Mensch zu Mensch da zu sein.