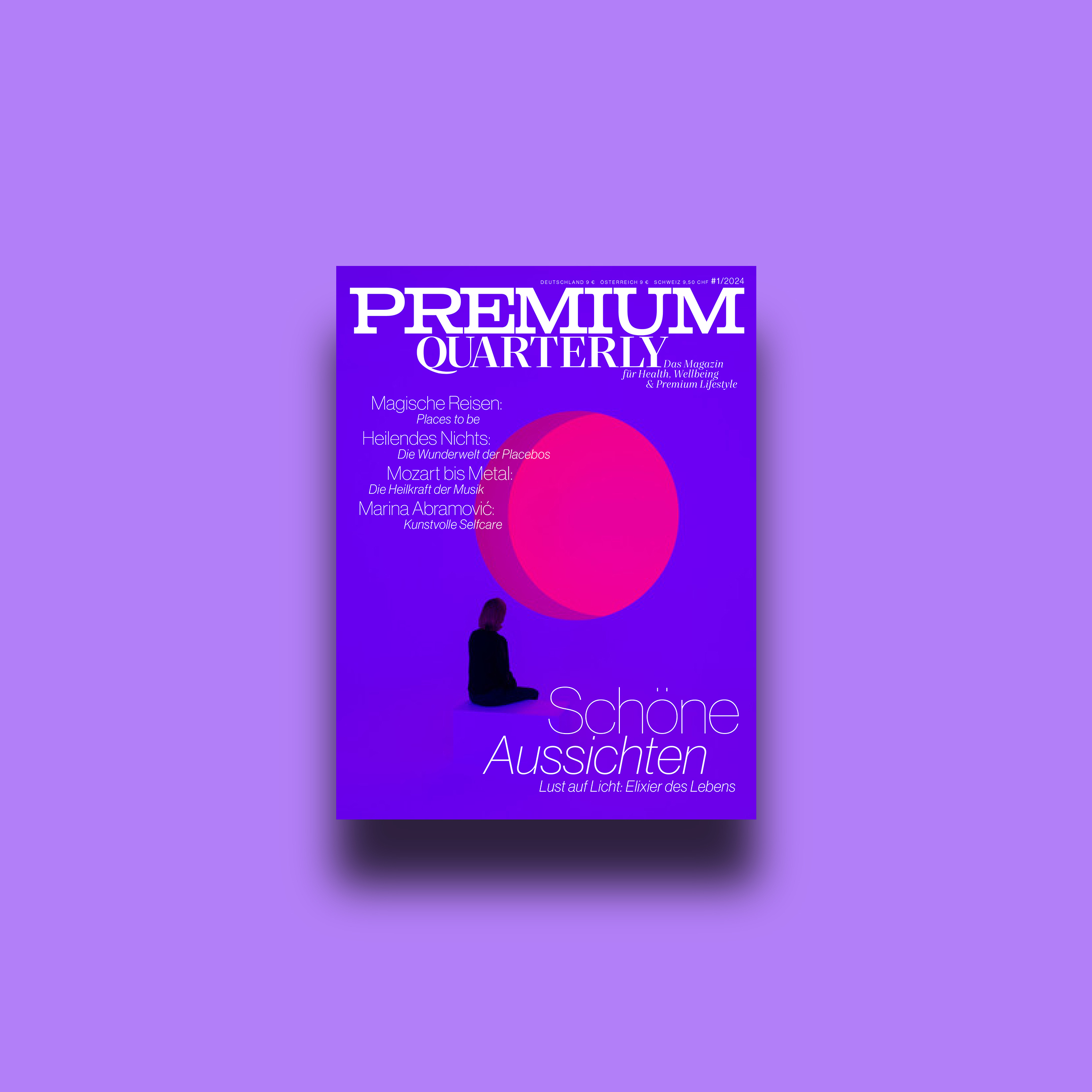Was ist eine Eigenbluttherapie?
Schon eine geringe Menge soll ausreichen, um das körpereigene Abwehrsystem und die Selbstheilungskräfte anzuregen. Die Rede ist von der Eigenbluttherapie, ein naturheilkundliches Verfahren, das von Heilpraktiker:innen und Ärzt:innen häufig bei Erkrankungen, die mit dem Immunsystem in Zusammenhang stehen, eingesetzt wird, etwa Allergien oder eine chronisch geschwächte Abwehrsituation. Dazu wird eine geringe Menge Blut aus der Vene entnommen und direkt an anderer Stelle, in den Gesäßmuskel oder unter die Haut, wieder eingespritzt. Das Eigenblut kann auch aufbereitet werden, indem es mit Sauerstoff oder Phytotherapeutika angereichert wird. Der Körper erkennt das eigene Blut als fremden Reiz und aktiviert das Abwehrsystem – eine klassische Immunreaktion.
Eigenbluttherapie wurde schon in den alten Kulturen von China bis Ägypten angewendet, wenn auch nicht so elegant wie heute. Doch bessere Wundheilung und Verjüngung waren bereits damals die Einsatzbereiche. Aber bis heute werden Verfahren und Wirkung aus wissenschaftlicher Sicht kontrovers diskutiert. „Leitlinien und Studien gibt es noch nicht ausreichend, sie umfassen häufig nicht ausreichende Patient:innenzahlen, und die Art der Aufarbeitung ist nicht einheitlich. Daher besteht hier noch Forschungsbedarf und die bisherigen Ergebnisse sollten kritisch hinterfragt werden“, so Prof. Dr. Sebastian Siebenlist, Leiter und Chefarzt der Sektion Sportorthopädie am Klinikum Rechts der Isar in München.
Wirkt die Eigenbluttherapie?
Kritisch hinterfragen bedeutet jedoch nicht, dass es nicht wirken kann, wie man aus der Erfahrungsmedizin weiß. So konnte auch in mehreren Studien gezeigt werden, dass Eigenbluttherapie für verschiedene Anwendungsgebiete in der Orthopädie zu einer Linderung der Beschwerden führen kann und teilweise sogar einer Cortison-Injektion überlegen ist. „Derzeit geht ein klarer Trend zu weniger körperfremden Substanzen hin zu mehr Einsatz von körpereigenen Materialien“, beobachtet Prof. Dr. Sebastian Siebenlist. Mit gutem Grund: „Die Eigenbluttherapie kann die Notwendigkeit einer Operation zurückstellen oder im besten Fall zur Vermeidung dieser führen. Bei der konservativen Therapie kann diese den Heilungsprozess beschleunigen und so auch den Einsatz von Schmerzmitteln reduzieren.“
Zur Anwendung kommt die Eigenbluttherapie vor allem bei überlastungsbedingten und degenerativen Erkrankungen. „Sie kann zum Beispiel bei einer Achillessehnenreizung oder einem Tennisellenbogen die Beschwerden lindern. Auch bei leichter bis mittlerer Arthrose kann sie die Schmerzen reduzieren, die Beweg- lichkeit des betroffenen Gelenks verbessern und so unter Umständen den Einsatz eines künstlichen Gelenks herauszögern“, so der Experte.
Was bewirkt die Eigenbluttherapie?
„Regenerationsprozesse von geschädigtem Gewebe bestehen aus komplex zusammenhängenden Einzelschritten und werden von sogenannten Wachstumsfaktoren geregelt. Diese werden unter anderem von den Blutplättchen, den Thrombozyten, freigesetzt. Durch das Einbringen dieser Faktoren am Ort der Schädigung werden Heilungs- und Regenerationsprozesse des geschädigten Gewebes unterstützt und vermehrt angeregt“, so Prof. Dr. Siebenlist. Über ein sogenanntes Autologes Conditioniertes Plasma-Verfahren (ACP) werden diese Zellen verarbeitet – autolog bedeutet körpereigen, conditioniert in dem Zusammenhang aufbereitet. Dazu wird dem Patienten zunächst eine bestimmte Menge Blut aus einer Vene entnommen und zentrifugiert. „Hierdurch setzen sich die schweren Blutbestandteile ab. Das Blutplasma mit den Thrombozyten und Wachstumsfaktoren kann so isoliert werden, und im Anschluss wird es unter sterilen Bedingungen in den Bereich des geschädigten Gewebes injiziert.“
Da es ein körpereigener Wirkstoff ist, wird die Injektion in der Regel gut vertragen, „einige Patienten berichten von einer kurzzeitigen leichten Aktivierung mit Schmerzen, Schwellung und diskreter Überwärmung im Bereich der Injektion“, berichtet der Arzt. Insgesamt dauert die Behandlung etwa eine Viertelstunde, und der Patient kann direkt danach nach Hause gehen. In den meisten Fällen werden bis zu drei Anwendungen im Abstand von mindestens einer Woche durchgeführt. Eine Evidenz bzw. Empfehlung der Häufigkeit der Anwendung gibt es aber bis dato nicht. Die Eigenbluttherapie gehört nicht zu den regulären Kassenleistungen. Manche privaten und gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Kosten jedoch nach Vereinbarung.